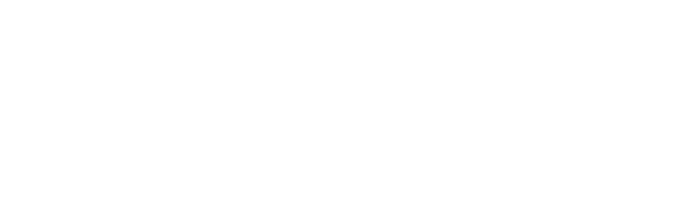
Ich gebe es gleich am Anfang zu: Die Frage »Was ist avancierte Rockmusik?« wird natürlich in diesem Vortrag nicht erschöpfend beantwortet werden. Aber ich denke auch nicht, daß einer der Anwesenden hier dies ernstlich erwartet haben wird. Die Ästhetik der Rockmusik steckt noch viel zu sehr in den Kinderschuhen, als daß definitive ästhetische Urteile gefällt werden könnten. Trotzdem habe ich nicht vor, bei unverbindlichem Larifari stehen zu bleiben; ich denke, die Ankündigung war zu entschieden formuliert, als daß ich mich aus der Verantwortung stehlen könnte. Es wird also um die Frage gehen, warum, wenn es so etwas wie avancierte Rockmusik überhaupt gibt, eher die Ramones dazuzurechnen sind als Pink Floyd.
So formuliert ist dies natürlich ein Geschmacksurteil, und dagegen ist zunächst einmal auch gar nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Tatsächlich sind die meisten Urteile, die über Musikstücke gefällt werden, die im weitesten Sinne der sogenannten Populärmusik zuzuordnen sind, Geschmacksurteile. Doch leider ist das ästhetische Geschmacksurteil nicht mehr das, was es einmal war.
In ihrer ursprünglichen Form war die ästhetische Kategorie des »Geschmacks« eine aristokratische Kategorie. Während der bürgerliche Parvenü zwar nichts von Kunst verstand, sich aber gerade deshalb Spezialisten hielt, nämlich Kunstkritiker, die ihm erklärten, was gute und was schlechte Kunst war, berief sich der Aristokrat auf seinen Geschmack. Mußte der Kunstkritiker, der für den Bürger schrieb, rational argumentieren, so verachtete der Aristokrat diesen zwanglosen Zwang des besseren Arguments und berief sich auf etwas, das sich rationaler Analyse vielleicht nicht entzog, diese aber zumindest nicht nötig hatte.
Gemeint war mit dieser Berufung auf den »Geschmack« keineswegs subjektive Willkür. Was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte war vielmehr die Tatsache, daß der Aristokrat von Kindesbeinen auf eine umfassende Erziehung genossen hatte, die ihn dazu befähigte, gute von schlechter Kunst unterscheiden zu können. Geschmack hat man nicht, Geschmack wird durch einen langwierigen Prozeß der Erziehung erworben; die Assoziation zur Welt der kulinarischen Genüsse ist nicht von ungefähr. So wie Kinder erst einmal lernen müssen, daß der wahre Genuß eben nicht darin besteht, möglichst viel Himbeereis in sich hineinzustopfen, sondern einen differenzierten Gaumen verlangt, der die herbe Reife eines Roqueforts genauso zu schätzen weiß wie die bittere Süße einer Mousse au Chocolat, so muß der Musikhörer lernen, der Schärfe eines verminderten Mollseptakkordes in seiner tonalen Auflösung nachzuschmecken. Ein differenziertes Ohr ist ebenso so schwer zu erwerben wie ein differenzierter Gaumen.
Selbstverständlich wandte sich der Aristokrat, der sich mit gutem Grund auf seinen Geschmack berief, voll Schaudern vor der bürgerlichen Kunstkritik ab, die sich damit beschäftigte, Kunstwerke analytisch auseinanderzuklauben, Kriterienkatalogie aufzustellen, Beurteilungen zu schreiben, kurz: die Aufklärung in den Bereich der Kunst vorzutreiben. Und doch lag ein Fortschritt in all diesen Bemühungen, den zu Geld gekommen Wursthändlern einen Zugang zur Kunst zu eröffnen. Der Genuß, zumindest war dies die Absicht, sollte demokratisiert werden. Mit dem Verfall des Bürgertums aber verfiel auch die Kunstkritik; das Bürgertum des 19. Jahrhunderts, das sich noch als Klasse sowohl nach oben, gegen die alte Aristokratie, wie nach unten, gegen das Proletariat legitimieren mußte, leistete sich noch den Luxus der Spezialisten, die ihm die Kunst erklärten, von der es selbst nichts verstand. Doch mit dem Niedergang des Bürgertums verfiel, mehr noch als die Kunst selbst, die Kunstkritik. Erst jüngst bemerkte Markus Lüpertz:
»Als Befähigung zur Kunstkritik scheint inzwischen die Lektüre einer Tageszeitung zu genügen. Kein Kritiker setzt sich mehr mit der Peinture der Malerei auseinander: mit einem Kremser Weiß, mit einem Schweinfurter Grün, mit einer Weißhöhung, mit einer Lasur. Das würde eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie notwendig machen.«1Inzwischen ist die Kunstkritik, die einmal gegen das Geschmacksurteil angetreten war, genau auf dieses zurückgefallen. Nur mit dem Unterschied, daß heute die Geschmacksurteile im seltensten Fall ihre klassische Berechtigung, nämlich ein in einem langwierigen Lernprozeß erworbenes Differenzierungsvermögen, besitzen. Doch über den bedauernswerten Zustand der Rockmusikkritik wird später noch zu klagen sein. Langer Vorrede kurzer Sinn: Obwohl ich denke, daß das Urteil, die Ramones hätten die deutlich bessere Musik gemacht als Pink Floyd evident ist, werde ich mir im folgenden trotzdem die Mühe machen, dies analytisch zu belegen; und zwar nicht, weil ich denke, daß man, um die Musik der Ramones zu verstehen, sie derart auseinanderdröseln muß, wie ich das später tun werde, sondern um dem ursprünglichen Geschmacksurteil eine Objektivität zu verleihen, die, um es Habermasianisch auszurücken, intersubjektiv verbindlich ist.
Bevor ich jedoch mit der konkreten Analyse zweier Stücke beginne, muß zunächst einmal eine Menge Schutt weggeräumt werden. In gut dialektischer Manier werde ich damit beginnen, die Unzulänglichkeit bestimmter Arten über Rockmusik zu reden und zu urteilen, aufzuzeigen. Im zweiten Teil, der Zuhörern ohne musikalische Vorbildung einiges abfordert, werde ich eine Analyse zweier Stücke durchführen, die dann im Schlußteil das Material abgeben wird, anhand dessen ich einige mir wesentlich erscheinende Kategorien für eine Ästhetik der Rockmusik entwickeln werde.
Ich beginne also mit einigen gebräuchlichen Arten, über Rockmusik zu reden und zu schreiben. Adorno hat in seiner Soziologie der Musik für die sogenannte »Ernste Musik« einen Katalog von Hörertypen aufgestellt, den für die Popmusik zu ergänzen ein sicherlich verdienstvolles Unterfangen wäre. Ich will hier einen Anfang machen und zumindest drei Hörertypen näher charakterisieren. Diese drei Typen, um die es im folgenden gehen wird, sollen kurz und knapp als der »Fan«, der »Musikkritiker« und der »Bildungsbürger« angesprochen und auch in dieser Reihenfolge abgehandelt werden.
Fangen wir mit dem »Fan« an. Mit dem »Fan« ist nicht einfach der Durchschnittskonsument gemeint. Der Durchschnittskonsument von sogenannter populärer Musik ist im Normalfall der Radiohörer, der sich gelegentlich einmal eine CD kauft, wenn ihm ein Ohrwurm besonders gefällt, und der diese dann nach dreimaligem Anhören im Regal verstauben läßt. Der Fan kauft mit gewisser Regelmäßigkeit Platten und ist dabei einigermaßen wählerisch. Er ist im Normalfall unter dreißig, noch nicht völlig in das Berufs- und Familienleben integriert; seine Kaufentscheidung ist wesentlich durch sein soziales Umfeld bedingt, was sich wiederum musikalisch durch die Bevorzugung beziehungsweise Ablehnung bestimmter Stile niederschlägt.
Während also der Durchschnittshörer einfach nur irgendein möglichst wenig störendes Hintergrundgedudel braucht, um unangenehme Stille zu vertreiben, gehört für den Fan »seine« Musik ganz wesentlich zur Selbstdefinition. Wer Punk hört, der hört nicht einfach nur Punk, sondern er bringt dadurch etwas über sich selbst zum Ausdruck, genauso wie jemand, der sogenannten »ProgRock« à la Pink Floyd auflegt. Von Aufklebern über T-Shirts bis hin zu Kalendern oder gar Automodellen wird dieser identitätsstiftenden Funktion musikalischer Stile von der Kulturindustrie Rechnung getragen.
Die Artikulationsfähigkeit hinsichtlich des musikalischen Geschehens, mit dem man sich identifiziert, ist beim Fan zumeist relativ dürftig. Ohne allzusehr zu übertreiben, dürfte die zentrale Kategorie für Musik, die er nicht mag, »Scheiße« sein, während Musik, die Gefallen findet, die Charakterisierung »geil« für sich in Anspruch nehmen darf. Soll genauer differenziert werden, greift man zum Mittel der Steigerung: »noch beschissener als...« beziehungsweise »geiler als...«. Damit ist aber meistens auch schon das Vokabuler erschöpft, das zur Beschreibung des musikalischen Geschehens herangezogen wird.
Alles andere, was der Fan zu »seiner« Musik zu sagen weiß, bezieht sich auf Äußerlichkeiten. Das Video, die Bühnenshow, die Stimmung beim Konzert, der »Sound«, das verwendete Equipment, gelegentlich, aber eher seltener, die Texte. Und schließlich sind natürlich noch die Musiker selbst ganz wichtig: Ihre internen Querelen, ihre Frauen- beziehungsweise Männergeschichten, ihr Drogenkonsum und so weiter. Was unter Garantie keine Rolle spielt, ist der musikalische Gehalt selbst. Wie ein Stück gemacht ist, welche Formelemente benutzt werden, wie das musikalische Geschehen harmonisch oder rhythmisch strukturiert ist.
Man mag zurecht einwenden, daß diese ganzen Dinge, die ich als Äußerlichkeiten bezeichnet habe, gerade in populärer Musik eine ganz wichtige Rolle spielen. Das will ich auch keineswegs bestreiten; ganz im Gegenteil: Bei irgendwelchen Boygroups lohnt es sich gar nicht, auch nur einen Gedanken an die Musik zu verschwenden. Hier geht das Ganze lückenlos in seiner Inszenierung auf. Doch auch bei weniger hirnlosen Darbietungen wird die Musik selbst gar nicht thematisiert. Tatsächlich existiert überhaupt kein Zusammenhang zwischen der Qualität der Musik und der Fähigkeit ihrer Hörer, sich zu dieser Qualität irgendwie sinnvoll zu äußern. Nehmen wir etwa unsere exemplarischen Beispiele, Pink Floyd und die Ramones, dann ist, wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar der Pink Floyd-Hörer eher in der Lage, einen Kommentar zum eigentlichen musikalischen Geschehen abzugeben als der Ramones-Fan.
Zum einen ist dieser Mangel an Artikulationsfähigkeit auf sachliche Gründe zurückzuführen: Zumeist fehlt einfach die musikalische Vorbildung, als daß eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem musikalischen Gegenstand möglich wäre. Doch ich denke, daß noch mehr dahintersteckt als mangelnde Ausbildung. Und zwar hängt dies mit dem identitätsstiftenden Gehalt zusammen, den die Musik seit den fünfziger Jahren vor allem für Jugendliche hat. Die Identifikation mit einem bestimmten Musikstil, insbesondere in der Pubertät, ist ganz wesentlich narzißtisch.
Gemeint ist damit, daß die Musik - und damit meine ich hier jetzt das gesamte Ensemble der Klanginszenierung - nicht als eigenständiges Objekt wahrgenommen wird, dem ein musikhörendes Subjekt gegenübersteht. Vielmehr zieht sich das pubertierende Individuum, unter anderem mit Hilfe der Musik, aus einer als feindlich empfundenen Objektwelt zurück und flüchtet sich in eine eigene Welt, in der er keine Brüche zwischen Subjekt und Objekt existieren, sondern unscharfe, symbiotische Verhältnisse vorherrschen. Derartig pubertärer Narzißmus ist völlig angemessen, schließlich macht das pubertierende Individuum den schmerzlichen Prozeß der Loslösung vom Elternhaus durch. Zwischen die aufzulösenden alten Verhältnisse und den Aufbau neuer, stabiler Objektbeziehungen, tritt im Normalfall ein objektloses, narzißtisches Stadium, und genau in diesem narzißtischen Zwischenstadium spielt die Musik eine ganz gewaltige Rolle.2
Eine analytische Zergliederung der Musik, die diese als eigenständiges Objekt wahrnimmt, würde natürlich die narzißtische Symbiose, die zwischen dem jugendlichen Fan und seiner Musik besteht, in Frage stellen. Und deshalb ist es meines Erachtens kein Zufall, daß eine intellektuelle, kritische Distanz, die das musikalische Objekt vergegenständlicht, vom wahren Fan nicht nur nicht betrieben, sondern verachtet bis verabscheut wird.
Damit eröffnet sich aber auch für die Rockmusikkritik ein beinahe unlösbares Dilemma: Sie muß über Musik schreiben, ohne daß sie diese als Objekt wirklich ernst nehmen darf. Und damit ist elegant übergeleitet zum zweiten Hörertypus, dem Musikkritiker.
Das Dilemma ist bereits benannt: Die Klientel, für die der Rockmusikkritiker schreibt, will eigentlich gar nichts über die Musik wissen, sondern nur seine bereits bestehenden Vorlieben bestätigt wissen. Und deshalb gibt es für pubertierende Jugendliche die BRAVO, in der sie alles, was sie über die Backstreetboys wissen wollen, erfahren können. Damit wollen wir uns allerdings nicht näher beschäftigen, denn es steht zu vermuten, daß den Lohnschreibern der BRAVO piepegal ist, worüber sie schreiben. Aber es gibt ja nicht nur die BRAVO...
Es gehörte zu den Eigentümlichkeit der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, daß die Adoleszenz, zumindest in den zwei Jahrzehnten nach '68, weit über die eigentliche Erlangung der Geschlechtsreife ausgedeht wurde. Dank Bafög kam ein nicht unbeträchtlicher Teil der damaligen Jugend in den Genuß einer außerordentlich verlängerten Pubertät; und in der Tat gibt es auch für derartige Langzeitpubertierende eine BRAVO, nur heißt sie eben nicht BRAVO, sondern SPEX.
Vom bloßen Fan unterscheidet sich der SPEX-Autor dadurch, daß er, zumindest gelegentlich, tatsächlich über Geschmack im klassischen Sinne der Kategorie verfügt. Da das Musikhören eine seiner Hauptbeschäftigungen darstellt, kennt er einfach mehr als der bloße Fan und kann in der Tat Qualitätsurteile fällen, die einer strengeren Kritik standhielten, wenn sie denn einer solchen unterzogen würden - zwar nicht immer, und auch immer seltener, aber die Trefferquote ist doch einigermaßen hoch. Während der Fan sich prinzipiell mit jeder x-beliebigen Musik identifizieren kann, sind dem Musikkritiker gewisse, wenn auch einigermaßen diffuse Grenzen für das gesetzt, was er gut finden kann und was nicht.
Ansonsten ist aber seine Artikulationsfähigkeit angesichts des musikalischen Objekts ähnlich begrenzt wie die des Fans. Das mag auf's Erste vielleicht verblüffen, denn schließlich ist es sein Beruf, sich zu Musik zu äußern. Und er kann ja wohl schlecht in die Fußstapfen des Fans treten und sich auf die einfache Logik des »find ich geil - find ich Scheiße«-Dualismus zurückziehen. Tja, das sollte man meinen. Faktisch kann er das aber sehr wohl. Man muß sich nur die Musikrezensionen in den einschlägigen Blättern ansehen. Dem zumeist nichtssagenden Text sind im Normalfall eine Reihe von Sternchen beigegeben, die andeuten sollen, in welchem Grade der Rezensent nun eine Platte geil oder Scheiße findet.
Zur allgemeinen Belustigung des Publikums könnte ich jetzt noch eine Zeitlang über den Typus des Rockmusikjournalisten herziehen, über seine stilistischen Manirismen und den lächerlichen Jargon, mit dessen Hilfe er zu kaschieren versucht, daß er eigentlich nicht in der Lage ist, sich qualifiziert zu seinem Gegenstand zu äußern. Doch zum einen gehört das nicht zum Thema, und zum anderen unterscheidet sich der Rockmusikjournalist hier nicht prinzipiell vom Journalisten an sich, höchstens daß die Diskrepanz zwischen der eigenen Aufgeblasenheit und dem mangelnden Wissen von dem, worüber man schreibt, noch größer ist als in anderen Sparten. Man stelle sich nur einen Wirtschaftsjournalisten vor, der sich deshalb für qualifiziert hält, weil er im Supermarkt einkauft; beim Musikjournalisten scheint es hingegen auszureichen, daß er einen CD-Player bedienen kann.
Natürlich ist das alles etwas ungerecht und übertrieben; und ich will gar nicht leugnen, daß es eine ganze Reihe von Musikjournalisten gibt, die durchaus in der Lage sind, brillante Essays über Popmusik zu verfassen. Doch auch bei den besten spielt die Musik im eigentlichen Sinn selten eine Rolle. Die Musiker, das soziale Umfeld, die gesellschaftlichen Bezüge, gelegentlich bestimmte Eigenheiten einer musikalischen Stilrichtung, das ist das Themenspektrum, innerhalb dessen sich auch die besten journalistischen Arbeiten im Bereich der Populärmusik bewegen. Die Literatur über die Sex Pistols füllt inzwischen sicherlich einige Regalmeter; Greil Marcus hat sogar einen 500 Seiten starken Wälzer über die geschichtsphilosophische Bedeutung der Sex Pistols verfaßt.3 Doch zur Musik selbst fallen immer nur einige Nebensätze. Ein Stück wie Anarchy In The UK wird immer nur als kulturelles Phänomen aufgefaßt, nicht als eigenständiges Kunstwerk.
Da ist der Gegner der Populärmusik um einiges konsequenter als diejenigen, die es sich zum Beruf gemacht haben, die Populärmusik zu verteidigen. Gehen wir deshalb über zum erklärten Gegner der Populärmusik, dem Bildungsbürger.
Ich gebe gleich zu, daß der dritte Typus, der »Bildungsbürger« eine Mogelpackung ist. Eigentlich gibt es ihn längst nicht mehr. Der Siegeszug der Populärmusik ist so allgemein, daß der klassische Bildungsbürger, der sich voll Schaudern von der Primitivität der Populärmusik abwendet, ausgestorben ist. Aber das macht nichts, denn eigentlich will ich mit diesem Typus auf jemand ganz konkreten hinaus, auf Theodor W. Adorno, genauergesagt auf dessen 1936 publizierten Aufsatz Über Jazz.
Daß Adornos Aufsatz vom Jazz handelt und nicht von Rockmusik, ist dabei weniger von Belang als man denken möchte. Leider, so muß man sagen, sind die meisten Argumente, die Adorno gegen den Jazz vorträgt, für die Rockmusik genauso gültig wie für den Jazz, eher sogar in gesteigertem Maße. Ich werde deshalb im folgenden einfach von Adornos Kritik der Populärmusik reden und nur dort auf spezifische Differenzen hinweisen, wo der Jazz der dreißiger Jahre anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht als die Rockmusik.
Wenn man sich Adornos Kritik der Populärmusik vornimmt, ist zunächst ein erstaunliches Paradoxon zu konstatieren. Während die selbsternannten Verteidiger der Rockmusik diese zumeist nur als gesellschaftliches Phänomen behandeln und die Musik selbst außen vor lassen, erklärt Adorno zwar, daß es nicht lohnt, sich mit der Musik selbst zu befassen, da sie voll und ganz in ihrer gesellschaftlichen Funktion aufgehe; doch dann sagt er auf den fünfundzwanzig Seiten des Aufsatzes mehr zum musikalischen Gehalt der Popmusik, als in den allermeisten Büchern zur Popmusik zu finden ist.
Ich will hier eines der mir zentral erscheinende musikalischen Argumente herausstellen, ohne noch genauer darauf einzugehen. Im Schlußteil dieses Vortrags werde ich jedoch noch einmal darauf zurückkommen.
Das gewichtigste und stichhaltigste Argument Adornos betrifft das Verhältnis von musikalischer Form zum Inhalt. Hier konstatiert Adorno für die Populärmusik eine unüberbrückbare Kluft. Die formalen Elemente der Musik werden unendlich stereotyp gehandhabt: Der Aufbau der einzelnen Perioden, die harmonischen Verhältnisse, der ewige Viervierteltakt, all das ist völlig vorhersehbar. Diesem Stumpfsinn der allgemeinen, formalen Elemente steht dann eine höchst subjektive Expressivität gegenüber. In rhythmischer Hinsicht etwa verhält es sich so, daß sich auf dem Fundament des stumpfsinnigen Viervierteltaktes eine komplexe synkopische Akzentuierung der Melodie erhebt, die jedoch das Gefängnis des zugrunde liegenden Rhythmus nicht zu sprengen vermag. Die Einfalt der Melodieführung wird dadurch kompensiert, daß aus Instrumenten und Stimme ein Höchstmaß an Expressivität herausgeholt wird. Hier präsentiert sich für Adorno das Saxophon als das Jazzinstrument par excellence - übrigens eine der wenigen Stellen, an denen Adornos Kritik veraltet ist: in den fünfziger Jahren hat die elektrifizierte Gitarre das Saxophon als Träger musikalischen Ausdrucks abgelöst. Diese Liste der absoluten Diskrepanzen zwischen den Konventionen der musikalischen Formgestaltung einerseits und den individuellen Ausdrucksmomenten andererseits könnte noch um eine ganze Reihe von Phänomenen erweitert werden, für unsere Zwecke reichen jedoch diese Andeutungen.
Bislang war nur vom musikalischen Sachverhalten die Rede. Zum Vorwurf werden sie erst durch ihre Interpretation. Dazu müssen kurz darauf eingehen, welch' zentrale Rolle das Verhältnis von musikalischer Form und individuellen Ausdruckselementen bei Adorno spielt. Denn dieses Verhältnis wird von Adorno spekulativ als Analogon zum Verhältnis von Gesellschaft und Individuum gedeutet. Und im Kontext von Adornos Musikästhetik heißt das dann, daß die große bürgerliche Musik versuchte, analog zu den bürgerlichen Anstrengungen in der Politik, den Widerspruch zwischen Besonderem und Allgemeinem, zwischen musikalischer Form und individuellem Ausdruck zu versöhnen. Die allgemeinen und die individuellen Momente sollten in der Komposition zu einem Ausgleich kommen. Doch so wie die Utopie bürgerlicher Demokratie, eines gerechten Ausgleichs von Individuum und Allgemeinheit chimärisch ist, so sehr mußten die großen bürgerlichen Kunstwerke am Versuch scheitern, allgemeine und besondere musikalische Momente zu vermitteln. Und den wirklich großen musikalischen Werke des Bürgertums, insbesondere denjenigen Beethovens, gelang es, dieses Scheitern selbst zum Erklingen zu bringen.
In der Populärmusik des zwanzigsten Jahrhunderts ist dieser Kampf, den die großen bürgerlichen Kunstwerke noch austrugen, längst entschieden. Während scheinbar eine viel größere Freiheit des Ausdrucks gestattet wird, ist das gesamte musikalische Geschehen durch starre musikalische Konventionen geregelt, die sich offensichtlich hinter dem Rücken der musikalischen Akteure durchsetzen. Die Freiheit, die die Populärmusik suggeriert, ist pure Ideologie. In Wirklichkeit regieren die eisernen Zwänge der musikalischen Form mit harter Hand die angebliche Individualität, die sich in populärer Musik ausdrücken will.
Am handgreiflichsten wird dies für Adorno im improvisierten Instrumentalsolo: Während sich der Künstler scheinbar vollkommen spontaner Kreativität hingibt, ist er doch in Wahrheit strikt an die harmonischen und formalen Gegebenheiten des Stücks gebunden. Im Solo drückt sich nicht die Freiheit des Individuums aus, sondern seine Unterwerfung unter die Regeln der Form.
Ich will jetzt die Berechtigung dieser Argumente gar nicht näher prüfen, denn dies würde nur in allgemeiner Geschwätzigkeit enden. Bevor wir auf die Stichhaltigkeit dieser bildungsbürgerlichen Vorwürfe eingehen, brauchen wir konkretes Material, an dem wir diese Thesen überprüfen können.
Die folgende Analyse zweier Stücke, nämlich Shine On You Crazy Diamond von Pink Floyd und zum anderen von Today Your Love, Tomorrow The World von den Ramones setzt zunächst einmal eine gewisse Beherrschung des Handwerkszeugs voraus. Anfangend im 18. Jahrhundert, vor allem dann aber im 19. Jahrhundert wurde ein reiches Instrumentarium entwickelt, mit Hilfe dessen musikalische Objekte beschrieben und analysiert werden können. Die Anwendung dieses Instrumentariums hat noch nichts mit Interpretation und schon gar nichts mit ästhetischer Beurteilung zu tun. Aber es ist ziemlich nützlich, um überhaupt einmal zu konstatieren, worüber man redet.
Ich kann hier keinen Schnellkursus in Harmonielehre, Rhythmik, Formenlehre, Melodielehre und Instumentationskunde verabreichen, obwohl das eigentlich notwendig wäre, damit ich hier eine wirklich qualifizierte Analyse des musikalischen Geschehens vortragen könnte. Da das nicht geht, muß ich einige Kompromisse schließen, das heißt, ich werde zwar versuchen, wenigstens ein paar Grundbegriffe zu erläutern, damit ich einige wesentliche Punkte, die dann für eine Interpretation und ästhetische Beurteilung benötigt werden, ansprechen kann. Doch ich kann nicht alle Fachtermini erläutern, die ich später benutzen werden; die folgende Einführung soll nur denjenigen, die noch überhaupt nie mit Musiktheorie in Kontakt gekommen sind, ein Paar Begrifflichkeiten an die Hand geben, damit sie dem groben Arugmentationsgang folgen können.
Ich will das Schwerste gleich an den Anfang stellen, die Harmonielehre. Ein oft zitiertes Bonmot über Punkmusik, die deren Primitivität herausstellen will, ist die Behauptung, man müsse nur drei Akkorde auf der Gitarre spielen können, um Punk-Musik zu machen. Das ist richtig und banal zugleich. In der Tat, insofern sich ein Musikstück im Rahmen einer Tonart bewegt - was für die sogenannte Populärmusik praktisch immer gilt - braucht man nie mehr als drei Akkorde zur Begleitung, genauer gesagt, es gibt überhaupt nicht mehr Akkorde. Ist die Tonart einmal festgelegt, dann gibt es exakt drei Akkorde des gleichen Tongeschlechts, die überhaupt verwendet werden können. In C-Dur etwa sind das der C-Dur-Akkord (was natürlich zu erwarten ist), dann der F-Dur und schließlich der G-Dur-Akkord. Und so läßt sich für jede Tonart genau angeben, welche drei Akkorde des selben Tongeschlechts zur Begleitung eines Stückes in dieser Tonart taugen.
Notenbeispiel 1: MOJO NIXON / COUNTRY DICK MONTANA, Drinkin' With Jesus, Takte 1-8.Das heißt, das Bonmot über Punk ist kein Bonmot, sondern eine Banalität. Trotzdem sind Stücke, die nur drei Akkorde verwenden, natürlich eher die Ausnahme. Doch dazu etwas später. Zunächst ein weiteres zu diesen drei Akkorden. Diese Akkorde sind nicht irgendwie willkürlich, sondern sie sind funktional aufeinander bezogen. Der Akkord, der den gleichen Namen trägt wie die Tonart, ist buchstäblich das Alpha und Omega des Stückes; von ihm geht harmonisch alles aus und zu ihm führt harmonisch alles hin, weshalb er im Normalfall das Stück eröffnet und es im Normalfall auch beendet.
Spricht man von diesem Akkord in seiner Funktion als Repräsentant der Grundtonart, so nennt man ihn Tonika. Die beiden anderen Akkorde heißen, nach ihrer Funktion betrachtet, Subdominante und Dominante. Die Funktion der Subdominante ist nicht so sonderlich wichtig, entscheidend ist die Dominante. Sie »leitet« zur Tonika hin, dient als zur Bestätigung der tonalen Funktion der Tonika. Deshalb kann man auch mit einiger Sicherheit davon ausgehen, daß der vorletzte Akkord eines Stückes die Dominante, der letzte Akkord hingegen die Tonika ist.
Notenbeispiel 2: MOJO NIXON / COUNTRY DICK MONTANA, Drinkin' With Jesus, Takte 9-16.Wie ich schon sagte, natürlich wird ein Stück nicht allein mit diesen drei Akkorden begleitet werden. Innerhalb einer Tonart gibt es nämlich noch drei weitere Akkorde, die benutzt werden können. Allerdings sind diese Akkorde im jeweils anderen Tongeschlecht angesiedelt. In C-Dur etwa wären dies a-moll, d-moll und e-moll. Funktional werden diese Akkorde als Parallelakkorde eingesetzt: a-moll ist die Tonikaparalelle, d-moll die Subdominantparallele und e-moll die Dominantparallele.
Kurz und gut: Wir haben also, wenn wir im Rahmen einer Tonart bleiben, drei Akkorde im selben Tongeschlecht wie die Gundtonart und drei Akkorde im anderen Tongeschlecht. Und damit läßt sich jetzt schon eine ganze Menge Musik machen. Im Normalfall werden überwiegend die drei Akkorde des gleichen Tongeschlechts wie die Grundtonart verwendet, die Parallelakkorde werden hingegen nur zur gelegentlichen Würze des Ganzen eingesetzt.
Notenbeispiel 3: MOJO NIXON / COUNTRY DICK MONTANA, Drinkin' With Jesus, Takte 17-26.Wir können also Akkorde auf zweierlei Arten bezeichnen: Zum einen absolut - wenn wir etwa vom C-Dur-Akkord reden, dann meinen wir damit einen ganz konkreten Klang. Oder aber funktional - wenn wir den Ausdruck Dominante gebrauchen, dann ist der Klang in seiner Funktion im harmonischen Formzusammenhang gemeint. Und es gibt noch eine dritte, sehr positivistische Bezeichnungsweise. Alle sechs Akkorde einer Tonart sind einem Ton der zugrunde liegenden Tonleiter zugeordnet. In unserem Beispiel C-Dur etwa heißt die Tonleiter c-d-e-f-g-a-h-c, wobei der C-Dur Akkord dem ersten Ton der Tonleiter zugeordnet ist, der d-moll-Akkord dem zweiten Ton und so weiter. Dies wird zu einer positivistischen Beschreibung der Akkorde verwendet, man spricht vom Akkord der I., der II., der III.... Stufe.
Ich habe es schon angedeutet, als ich die Funktionalität der Akkorde angesprochen habe: Wie Akkorde aufeinander folgen ist nicht einfach willkürlich, sondern eben durch ihre Funktion bestimmt. So steht normalerweise die Tonika am Anfang eines Stückes, um dem Hörer die Tonart mitzuteilen, und sie steht auch, bestätigt durch die Dominante, am Ende, um dem Hörer das Ende des Stücks mitzuteilen. Und so gibt es eine ganze Reihe formaler Konventionen, die den harmonischen Aufbau eines Stücks regeln. Und das gilt für Beethoven-Symphonien ebenso wie für Country-Balladen.
Das heißt, harmonische Funktionen und die Form des Stückes sind eng miteinander verzahnt. Daß der Parallelakkord vorhin in unserem Demonstrationstück an der Stelle kam, an der er kam, war keineswegs Zufall, sondern ist durch den formalen Aufbau quasi determiniert. Drinkin' with Jesus ist eine Variante der 32-taktigen Standardliedform. Diese Form ist das beliebteste und häufigste Modell, das in der Populärmusik verwendet wird.
Der Aufbau dieser Form ist ziemlich einfach: Die zweiunddreißig Takte werden in 8-taktige Teile zerlegt, so daß wir summa summarum auf vier Teile kommen. Erst kommt der Hauptteil, dieser wird dann noch einmal wiederholt. Dann kommt ein neuer Abschnitt, der »Bridge« genannt wird. Und am Ende schließt sich eine letzte Wiederholung des Hauptteils an.4
Es ist nicht schwer zu erraten, wo vorhin bei Drinkin' with Jesus die Tonikaparallele eingesetzt wurde: Es war im Übergang zu Teil drei, also zur Bridge. Für die Bridge ist gefordert, daß sie musikalisch etwas Neues bringt, und dazu gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von der einfachen Verwendung von Parallelakkorden oder der Veränderung des Rhythmus bis hin zu Tonartwechseln. Um jetzt nicht noch einmal mit einer von mir vorgetragenen Version von Drinkin' with Jesus zu nerven, ein anderes Stück, das diese a-a-b-a Struktur eines Songs ziemlich eindeutig demonstriert:
Musikbeispiel 1: THE DWARVES, I Wanna Be Your PimpDies muß jetzt als knappe Einleitung in die musikalische Analyse genügen. Und damit in media res, zu Shine On You Crazy Diamond von Pink Floyd.
Es ist unmöglich, Shine On You Crazy Diamond von Pink Floyd hier im Ganzen zu diskutieren. Da allein die erste Hälfte rund eine Viertelstunde dauert, bräuchten wir mehr Zeit, um das Stück anzuhören als ich gewillt bin, für die Analyse zu opfern. Das ist allerdings nicht weiter tragisch, denn Shine On You Crazy Diamond, Part 1, besteht schon alleine aus fünf Teilen, die ohne weitere Probleme getrennt behandelt werden können, da de facto kein innerer Zusammenhang besteht. Tatsächlich sind die einzelnen Abschnitte von unterschiedlichen Mitgliedern der Band »komponiert« und später zusammengefügt worden, was, wie ich denke, auch einem ungeschulten Ohr sofort auffällt.
Deshalb ist es legitim, sich auf einen einzigen Teil zu beschränken, nämlich Teil 4, den eigentlichen Song Shine On You Crazy Diamond. Tatsächlich ist dieser Teil der einzige, der einige musikalische Kontur besitzt; die anderen Teile versuchen hauptsächlich, Stimmungen und Bilder zu evozieren. Die narzißtische Objektlosigkeit, in der sich das pubertäre Musikhören eine ozeanische Verschmelzung mit der Musik imaginiert, wird hier tatsächlich auf's Beste bedient. Um dies zu hören, bedarf es keiner erschöpfenden Analyse. Nehmen wir uns also nur den musikalisch interessantesten vierten Teil vor.
Dieser Teil folgt einigermaßen exakt dem vorhin beschriebenen und demonstrierten a-a-b-a-Schema. Ich werde das Stück jetzt einmal Vorspielen und beim Vorspielen auf die einzelnen Teile hinweisen.
Musikbeispiel 2: PINK FLOYD, Shine On You Crazy Diamond, Part 4Kurz noch einige nachträgliche Bemerkungen zur Form. Es fällt natürlich sofort auf, daß das Stück ungewöhnlicherweise nicht im 4/4-Takt, sondern im 3/4-Takt gehalten ist; ansonsten ist der Aufbau einigermaßen sauber in 8-taktigen Phrasen gehalten, nur im Übergang zwischen den Hauptteilen sind gelegentlich einige wenig motivierte Takteinschübe zu finden. Wie es sich gehört, ist der Kontrast zwischen Hauptteil und Bridge sauber herausgearbeitet und wird auch durch einen Tonartwechsel unterstrichen: Während der Hauptteil in H-Dur steht, ist die Bridge in der Paralleltonart gis-moll gehalten.
Ins Ohr sticht bei diesem Stück sofort die kühne Harmonik, und in der Tat sind Pink Floyd ja für die harmonische Komplexität ihrer Stücke berüchtigt - weshalb wir uns jetzt die harmonischen Verhältnisse etwas genauer ansehen.
Beginnen wir etwas ungewöhnlich mit der zweiten Hälfte des Hauptteils, also der titelgebenden Verszeile »Shine on you crazy diamond«. Hier ist der harmonische Verlauf ziemlich einfach: Von der Subdominante über die Dominant- und die Subdominantparallele zu Tonika, um dann mit der Dominante zu enden. Oder um das ganze als Stufenverlauf auszudrücken: IV-III-II-I-V. Das ist nicht besonders originell, aber handwerklich solide gemacht, und es gibt noch ein harmonischen Bonbon: Im zweiten Takt, wo die Harmonien von E-Dur auf dis-moll wechseln, bleibt die Gesangsstimme noch für zwei Schläge auf dem gis stehen, während der Akkord bereits gewechselt hat, was raffinierterweise zu einem kleinen Querstand führt.
Notenbeispiel 4: PINK FLOYD, Shine On You Crazy Diamond, Takte 9-10.Aber diese winzige gelungen Stelle macht aus Shine On You Crazy Diamond leider noch kein Meisterwerk. Denn so solide wie die Refrainzeile ist, so gepfuscht wird in der ersten Phrase. De facto haben wir hier nur die Harmoniefolge Dominantparallele-Tonika.
Notenbeispiel 5: PINK FLOYD, Shine On You Crazy Diamond, Takte 1-8, mit H-Dur-Akkordwechsel bereits in Takt 5.Natürlich spielen Pink-Floyd das nicht so. Zwischen den dis-moll und den H-Dur-Akkord wird ein tonartfremder Akkord, D-Dur eingeschoben, und schon klingt das Ganze viel aufregender:
Notenbeispiel 6: PINK FLOYD, Shine On You Crazy Diamond, Takte 1-8, mit »korrektem« D-Dur-Akkord in Takt 5.Faktisch aber ist dieser Einsatz eines leiterfremden Akkordes durch überhaupt nichts legitimiert, er klingt nur etwas seltsam, und zwar aus dem einfachen Grund, weil er dort, wo er steht, überhaupt nichts zu suchen hat. Möglich ist das Ganze deshalb, weil der dis-moll-Akkord durch eine einfache Verschiebung des Grundtons und der Quinte um einen Halbton nach unten in einen D-Dur-Akkord überführt werden kann.
So etwas kann zur Not gemacht werden. Um etwa von H-Dur nach G-Dur zu modulieren wäre eine Akkordfolge wie H-dis-D-G möglich, wenn auch nicht besonders gelungen:
Notenbeispiel 7: Modulation H-dis-D-GIn so einem Fall legitimierte sich eine solche Verschiebung durch den harmonischen Zusammenhang, in dem sie steht. Doch als Verbindungsglied zwischen dis-moll und H-Dur ist ein D-Dur-Akkord eine Absurdität. Dieser Akkord ist einfach auf die Sequenz aufgeklatscht, weil sonst ihre ganze melodische und harmonische Leere offenkundig wäre. Irgendeine Funktion hat dieser Akkord an dieser Stelle nicht, außer eben die, ein musikalisches Loch zu verkleiden. Kurz und gut: Es handelt sich einfach um einen musikalischen Effekt. Und was das ist, hat Richard Wagner, der schließlich etwas davon verstand, sehr treffend definiert: eine Wirkung ohne Ursache. Um eine allgemeine und unbewiesene Behauptung zu wagen: Die meisten der scheinbar interessant klingenden Stellen bei Pink Floyd gehorchen dieser musikalischen Unlogik des Effekts. Sie sind als bloß äußerlich Zutat einer im Normalfall wenig originellen musikalischen Grundstruktur hinzugefügt.
Die Bridge braucht hier nicht detailliert durchgesprochen werden, nur einige Hinweise: Auch hier wird der ausführlich für den Hauptteil besprochene Effekt, nur in einer anderen Tonart, durchgespielt. Statt einer Verschiebung von dis-moll nach D-Dur erfolgt nun eine von gis-moll nach G-Dur. Allerdings ist diese Wiederholung nicht so penetrant, weil nun auf den G-Dur-Akkord nicht der analog zum Hauptteil zu erwartende E-Dur, sondern wiederum ein H-Dur-Akkord folgt. Dadurch erhält die Akkordverbindung wenigstens den Hauch einer modulatorischen Logik. Dieser wird allerdings dadurch wieder zunichte gemacht, daß ein völlig unmotivierter Cis-Dur-Akkord angehängt wird.5
Die zweite Hälfte der Bridge ist dann, zumindest was die Harmonik an sich anbelangt, einigermaßen solide. Das Problem, so man denn hier eines sehen will, liegt in der Melodieführung: Die chromatische Aufwärtsbewegung entfaltet eine eine starke Sogwirkung, die durch die Harmonien, die hier starke Dominantwirkungen evozieren, noch verdoppelt wird. Und im Text wird das weiter gesteigert, indem die Verszeilen durch fortlaufende Verkürzungen etwas Atemloses bekommen: »Come on you target for far away laughter, come on you stranger, you legend, you martyr and shine!«. Kurz: Melodik, Harmonik und Text werden strikt parallel geführt, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Mir persönlich ist das zu dick aufgetragen, zu bombastisch; aber in einem rein handwerklichen Sinn ist das, im Gegensatz zum ersten Teil der Bridge, nicht schlecht gemacht.
Hören wir uns das Ganze jetzt noch einmal an:
Musikbeispiel 3: Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond, Part 4.
Und nun zu unserem zweiten Stück, Today Your Love, Tomorrow The World von den Ramones. Auch dieses Stück lehnt sich formal an die 32-taktige Liedstruktur an, allerdings entfällt der letzte Hauptteil, statt 32 Takten haben wir also dreimal acht Takte. Diese vierundzwanzigtaktige Struktur wird dreimal gespielt, das erste Mal rein instrumental, dann zweimal mit dem selben Text. Und am Ende wird dann die titelgebende Verszeile in einem eigenen Abschnitt fünfmal wiederholt.
Musikbeispiel 4: THE RAMONES, Today Your Love, Tomorrow The WorldVon der formalen Struktur des Stückes her unterscheiden sich die Ramones nicht wesentlich von Pink Floyd. Deutlicher Bezugspunkt ist die selbe 32-taktige Songstruktur, wobei beide Modifikationen anbringen: Pink Floyd verwenden einen 3/4-Takt und nehmen es mit der Anzahl der Takte insgesamt nicht so ganz genau, die Ramones hingegen lassen die Wiederholung des Hauptteiles nach der Bridge weg, halten sie sich aber sonst strikt an die Form.
Auch findet sich, wie bei Pink Floyd, in der Bridge eine neue Tonart. Waren Pink Floyd in die Paralleltonart ausgewichen, wechseln die Ramones stattdessen das Tongeschlecht: aus dem a-moll des Hauptteils wird in der Bridge A-Dur. Damit sind aber auch schon alle Parallelen zwischen Shine On You Crazy Diamond und Today Your Love, Tomorrow The World aufgezeigt.
Denn die Harmonik ist bei den Ramones völlig anders strukturiert: Harmonische Effekte, wie wir sie bei Pink Floyd gefunden haben, gibt es in diesem Stück nicht. Der Hauptteil kommt mit drei Dur-Akkorden aus:
Notenbeispiel 8: THE RAMONES, Today Your Love, Tomorrow The World, Takte 1-8.Und in der Bridge genügen zwei Dur Akkorde:
Notenbeispiel 9: THE RAMONES, Today Your Love, Tomorrow The World, Takte 9-16.Womit wieder einmal die harmonische Simplizität von Punk-Musik bewiesen wäre: Pink Floyd scheitern zwar recht häufig an den Klippen der Harmonielehre, aber immerhin versuchen sie, ihren Hörern etwas mehr als die üblichen drei Dur-Akkorde zu liefern. Es scheint nun wieder eine Geschmacksfrage zu sein, ob man das ambitionierte Scheitern von Pink Floyd der tadellosen Primitivität der Ramones vorzieht oder umgekehrt.
Doch leider ist das falsch: Tatsächlich ist die harmonische Struktur von Today Your Love, Tomorrow The World weit davon entfernt, primitiv zu sein. Ich hatte vorhin schon en passant bemerkt, daß der Hauptteil in a-moll stünde. Und auf einmal zeigt sich, daß die drei Dur-Akkorde, die die Ramones zur Begleitung dieses in moll stehenden Teiles verwenden nicht die üblichen drei trivialen Akkorde sind, die die Tonart hinreichend definieren. In a-moll wären dies nämlich a-moll, d-moll und e-moll. Nun könnte man erwarten, daß die drei Akkorde, die die Ramones verwenden, einfach die Parallelakkorde C-Dur, F-Dur und G-Dur sind. Das ist aber auch nicht der Fall. Es werden zwar in der Tat C-Dur und G-Dur verwendet, der dritte Akkord ist aber E-Dur.
Dieser E-Dur-Akkord ist nicht so verwunderlich, wie es zunächst erscheinen mag. In moll-Tonarten wird nämlich der Akkord auf der fünften Stufe, wenn er in Dominant-Funktion eingesetzt wird, von moll nach Dur umgewandelt, weil moll-Akkorde keine Dominant-Funktion ausüben können. Und in genau dieser Funktion taucht hier der E-Dur-Akkord auf. Der Hauptteil wird also nicht wie üblich mit Tonika, Subdominante und Dominante harmonisiert, sondern mit Tonikaparallele, Dominantparallele und Dominante.
Die eigentliche Grundtonart, a-moll, taucht hingegen überhaupt nicht auf. Diese ist zwar durch das Akkordgefüge eindeutig definiert, denn diese Akkordkombination ergibt nur in einer einzigen Tonart einen Sinn, nämlich in a-moll (und die Melodieführung bestätigt diese Tonart), doch die eigentliche Bestätigung der Tonart bleibt aus. Dadurch erhält der Hauptteil einen höchst eigentümlichen Charakter: Einerseits ist er tonal eindeutig festgelegt, andererseits wirkt diese Festlegung höchst unsicher und fragil. Hier könnte nur eine klare und eindeutige Bestätigung durch den Tonika-Akkord Abhilfe schaffen, doch genau diese Bestätigung wird verweigert.
Notenbeispiel 10: Abschluß der Akkordfolge C-G-E durch am.Diese Unsicherheit setzt sich in der Bridge fort, die nun das Tongeschlecht wechselt und durch die Verwendung des D-Dur-Akkordes den Wechsel von a-moll nach A-Dur anzeigt. Auch hier wird der Tonika-Akkord ausgespart, stattdessen werden nur Subdominante und Dominante verwendet. Die harmonische Instabilität aus dem Hauptteil bleibt bestehen. Allerdings ist hier die Instabilität nicht so krass wie im Hauptteil. Hatte der Hauptteil dadurch verwirrt, daß nicht nur die Tonart verunklart wurde, sondern auch das Tongeschlecht, ist zumindest letzteres in der Bridge eindeutig. Trotzdem: Im dreimaligen Wechsel von Hauptteil und Bridge wechseln sich zwei harmonisch ungefestigte Teile fast dialogisch ab.
Erst der scheinbar so sinnlos angehängte Schlußteil bringt mit einem triumphalen A-Dur-Akkord erstmals die Bestätigung der Tonart. Und dies wird noch weiter dadurch prononciert, daß die Ramones das Tempo des Stückes deutlich drosseln, damit diese Bstätigung der Tonart noch wuchtiger ausfällt. Zum ersten Mal taucht eine saubere A-Dur Kadenz: A-Dur, D-Dur, E-Dur auf. Diese Kadenz wird dann zwar mehrfach wiederholt, doch die korrekte Auflösung wird uns auch diesmal wieder verweigert: Nach dem allerletzten Dominatakkord E-Dur wäre ein abschließender A-Dur Akkord zu erwarten. Doch genau dieser A-Dur-Akkord, der die ganzen harmonischen Irritationen auflösen könnte, wird verweigert. Der E-Dur-Akkord bleibt wie festgefroren in der Luft hängen, bis sich eine dünne Gitarrenrückkopplung herausspinnt, die dann ins Nichts abstürzt. Wieder einmal sind wir um die Bestätigung der Tonart betrogen worden.
Hören wir uns den Schluß noch einmal an:
Musikbeispiel 5: Schlußteil RamonesSoviel zur rein formalen Beschreibung von Today Your Love, Tomorrow The World. Diese harmonischen Sachverhalte folgen jedoch nicht nur immanent einer stringenten musikalischen Logik, sondern stehen in engem Zusammenhang mit dem Text. Der Text des Hauptteils heißt:
»Na ja, ich bin ein SS-Mann und etwas nebs der Kapp. Ich bin ein Nazi-Schatzi, weißt du, ich kämpfe für's Vaterland.«6Es handelt sich also um das Imponiergehabe eines jungen Nazis, der meint, er könne ein Mädchen damit beeindrucken, daß er bei der SS ist. Die Musik hingegen konterkariert dieses Imponiergehabe auf unnachahmliche Weise: Einerseits ist das Dur, das die Harmonien suggerieren, pure Oberfläche, unter der sich ein schwächliches Moll versteckt. Zum anderen taucht dieses a-moll, das der Aussage eigentlich Festigkeit geben könnte, nie auf. Hinter der scheinbaren Selbstsicherheit steckt also, so verrät die Musik, ein armseliges, unsicheres Würstchen, das sich nur aufbläht, dem es aber eigentlich an einem festen Halt mangelt.
Dieser Meinung ist auch der Sozialarbeiter, dessen Stimme wir in der Bridge hören:
»Kleiner, deutscher Junge, der nur herumgestoßen wird; kleiner deutscher Junge in einer deutschen Stadt.«7Und der Sozialarbeiter, der den kleinen, deutschen Jungen bedauert, statt ihm rechtzeitig eine in die Fresse zu geben, leidet an der gleichen Krankheit wie der Nazi. Auch hinter seinem verständnisvollen Geschwätz versteckt sich eine fundamentale Unsicherheit; zwar denkt er, daß er alles im Griff hat, doch das wird sich als Irrtum herausstellen.
Denn bei der letzten Wiederholung der Bridge wird ihm erbarmungslos das Wort abgeschnitten. Statt »Little German boy in a German town« bekommt er nur noch ein »Little German boy in a German« heraus: Dann macht ihn ein brachiales »eins-zwei-drei-vier« mundtot und der Jungnazi triuphiert als ausgewachsener Nazi im A-Dur, das er dem Sozialarbeiter abgenommen hat: »Heute deine Liebe und morgen die ganze Welt!« Der einzige musikalische Hoffnungsschimmer, daß diese Rechnung nicht aufgeht, steckt im abgebrochenen Ende des Schlußteils, der fehlenden Tonika.
Oder um das alles kürzer auszudrücken: Mit einem Minimum an Text und einem Minimum an musikalischen Mitteln haben die Ramones mit Today Your Love, Tomorrow The World einen Antifa-Song geschrieben, der den Verleich mit Brecht und Eissler nicht zu scheuen braucht. Text und Musik beziehen sich nicht nur aufeinander, sondern bilden tatsächlich eine durchstrukturierte Einheit, in der sie sich gegenseitig ergänzen und kommentieren.
Hören wir uns jetzt noch einmal das Ganze an:
Musikbeispiel 6: THE RAMONES, Today Your Love, Tomorrow The World
Damit hätten wir die reine Analyse, so weit ich sie treiben wollte, fast hinter uns gebracht. Eine ganz wesentliche Differenz zwischen Pink Floyd und den Ramones kam allerdings noch nicht zur Sprache. Hans Eisenbeiss, der wahrscheinlich als erster auf das Phänomen aufmerksam gemacht hat, hat dafür den Fachterminus Fuzz geprägt, den ich im folgenden auch beibehalten möchte. Was Fuzz ist, läßt sich leichter demonstrieren als erklären. Deshalb spiele ich jetzt zwei mal den Anfang des selben Songs, einmal in einer Version ohne und dann in einer Version mit Fuzz:
Musikbeispiel 7: KITTY WELLS, Makin' Believe, AnfangFuzz geht auf die Anfänge des Rock'n'Roll zurück, auf Rocket 88 von Jackie Brenston & his Delta Cats. Zumindest will es die Legende so, daß Brenston und seiner Band, als sie 1951 zu einer Aufnahmesession in die inzwischen legendären Sun Studios in Memphis fuhren, der Gitarrenverstärker vom Autodach fiel. Da das Gerät sich nicht reparieren ließ, spielten sie Rocket 88 eben mit dem scheppernden Klang ein, der sich dem Verstärker nach diese Sturz noch entlocken ließ. Und das war, so geht die Legende, die Geburtsstunde des Rock'n'Roll und die von Fuzz.Musikbeispiel 8: SOCIAL DISTORTION, Makin' Believe, Anfang.
War Rocket 88 noch dem Zufall geschuldet, so ist das legendärsten Fuzz-Stücke aller Zeiten das Resultat gezielter Manipulationen. Angeblich piekste Link Wray sogar mit einem Kugelschreiber Löcher in die Membran seiner Lautsprecherbox, um 1957 den scheppernden, verzerrten Klang seines legendären Rumble zu erzielen.
Und natürlich unterscheidet sich Today Your Love, Tomorrow The World vor allem dadurch von Shine On You Crazy Diamond, daß es ein komplett von Fuzz durchtränktes Stück ist. Sicher, auch bei Pink Floyd gibt es eine verzerrte Gitarre, ein ganzes Gitarrensolo in Teil 3 von Shine On You Crazy Diamond ist über den Verzerrer gespielt. Doch bei Pink Floyd wird der verzerrte Klang als distinkter Klangeffekt eingesetzt - und das hat nichts mit Fuzz zu tun. Fuzz ist kein musikalischer Bedeutungsträger in dem Sinn in dem eine Akkordverbindung oder auch eine bestimmte Instumentierung Bedeutungsträger sein kann. Fuzz ist eine völlig monotone Angelegenheit: Zweiundzwanzig Jahre lang wurde jedes Stück der Ramones vom gleichen scheppernden, verzerrten rückgekoppelten Gitarrenklang umspült und getragen. Fuzz bedeutet nichts, sondern Fuzz ist. Philosophisch ausgedrückt: Fuzz ist reines Sein an sich, kein Sein für anderes.
Was damit gemeint ist, muß an dieser Stelle noch etwas dunkel bleiben, denn um diese an Mystik gemahnende Definition von Fuzz zu vestehen, müssen wir die Ebene der bloß empirischen Konstatierung musikalischer Tatbestände verlassen und zur Ästhetik des Rock'n'Roll übergehen.
Kehren wir noch einmal zu Adornos Hauptvorwurf, den er gegenüber der Populärmusik erhoben hat, zurück. Es war dies die Behauptung, daß das Freiheitsversprechen der Populärmusik in Wirklichkeit bloße Ideologie ist. Unter der Oberfläche des scheinbar freien musikalischen Ausdrucks ist in Wirklichkeit eine geschichtslose Stereotypie am Werke, die alle Individualität Lügen straft.
Dem scheint die Entwicklung der Rockmusik zu widersprechen. Zugegeben, in den fünfziger Jahren war der Rock'n'Roll eine ziemlich primitive und stumpfsinnige Angelegenheit. Aber hat sich das nicht in den sechziger Jahren geändert? Haben nicht die Beatles angefangen, immer komplexere musikalische Gebilde zu konstruieren, und sind Pink Floyd nicht ihre legitimen Nachfolger? Versucht nicht die Populärmusik der späten sechziger und frühen Siebziger, sich den Qualitätsstandards der großen bürgerlichen Musik anzunähern?
In der Tat, das versuchte sie. Es begann mit dem exzessiven Einsatz von Parallelakkorden bei den Beatles und es endete bei musikalischen Großformen wie Shine On You Crazy Diamond. Mehrsätzig! Komplizierte Harmonien! Dreivierteltakt! Wird hier nicht der Anschluß an die große bürgerliche Musik versucht? So ist es. Und das Resultat ist kläglich. Die Mehrsätzigkeit von Shine On You Crazy Diamond ist reiner Lüge. Von einer in sich integrierten Großform kann nicht die Rede sein; hier sind nur an die Stelle von Leerrillen schnell und meist schlecht zusammengebastelte Übergänge getreten. Und abgesehen von dem vorhin analysierten Teil IV hat, selbst nach Popmaßstäben gemessen, keiner der anderen Teile für sich das Zeug, eigenständig bestehen zu können. Teil IV hingegen ist der üblichen a-a-b-a-Struktur unterworfen. Das harmonische Geschehen ist in Wirklichkeit trivial, und wo es das nicht ist, ist es einfach musikalischer Quatsch. Das Gitarrensolo im dritten Hauptteil ist nicht nur eingepfercht in die streng durchgehaltene Akkordstruktur des Hauptteils, es kann sich noch nicht einmal souverän von der durch den Gesang vorgegebenen Melodielinie lösen. Wer Shine On You Crazy Diamond als Anschluß an die große bürgerliche Musik des 19. Jahrhunderts verkaufen will, ist ein Scharlatan. Mit anderen Worten: So gut wie alle Vorwürfe, die Adorno 1936 gegen den Jazz erhoben hat, sind für die Musik Pink Floyds noch genauso gültig, wie sie es zum Zeitpunkt ihrer Formulierung gegen Duke Ellington waren.
Tatsächlich führte der in den sechziger Jahren gestartete Versuch, die Infantilität des frühen Rock'n'Roll zu überwinden zu noch größerer Infantilität, nämlich Infantilität gepaart mit Größenwahn. Die Beatles glaubten wirklich, sie seien größer als Mozart. Der Anspruch der Popmusiker, nicht als Entertainer, sondern als richtige Musiker ernstgenommen zu werden, indem sie sich bemühten, »komplexer« zu werden, führte ästhetisch in eine absolute Sackgasse. Der Reichtum des musikalischen Materials und der musikalischen Ausdrucksmittel, die dem 19. Jahrhundert noch zur Verfügung standen, ist endgültig dahin. Selbst wenn Pink Floyd ihr Handwerk besser verstünden, in ästhetischer Hinsicht käme doch keine besser Musik dabei heraus. Die Möglichkeiten des tonalen Systems europäischer Prägung sind im 19. Jahrhundert so ausgereizt worden, daß daran nicht mehr angeknüpft werden kann.
Tatsächlich ist die Lösung des zentralen ästhetischen Problems der Populärmusik, die Übermacht der Formelemente über die Ausdruckselemente der Musik gar nicht dadurch zu lösen, daß man nach neuen Möglichkeiten des Ausdrucks sucht, um so die Ausdrucksseite der Musik zu stärken. Kritische oder avancierte Rockmusik hätte vielmehr im Gegenteil die Aufgabe, die Ausdruckselemente der Musik zu eliminieren, um die nackte Herrschaft der Form herauszustellen. Ihre kritische Aufgabe wäre es, die von Popmusik verbreitete Ideologie, es könne bei den herrschenden musikalischen und gesellschaftlichen Verhältnissen so etwas wie frei entwickelte Individualität geben, Lügen zu strafen.
Und dieser Aufgabe wird die Musik der Ramones, im Gegensatz zu der von Pink Floyd, in weitem Maße gerecht. Das beginnt bei der Anonymität der Musiker, die sich hinter den Pseudonymen Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone und Marky Ramone verstecken. Das setzt sich in Äußerlichenkeiten wie dem Auftreten der Musiker fort: Die völlig banale Bekleidung aus Jeans, T-Shirt, Lederjacke und Turnschuhen, die ins Gesicht fallenden Haare und die Sonnenbrillen rauben den Musikern jede Individualität. Um hier eine Anekdote einzuflechten: Als sich Dee Dee Ramone zu den Hochzeiten des Punk einen bunten Iro stehen lassen wollte, wurde er von den anderen Bandmitgliedern daran gehindert.
In den Texten drückt sich nicht der Sänger aus, sondern er schlüpft in die Rolle aller möglicher depravierter Individuen wie etwa der des Nazis und des Sozialarbeiter in Today Your Love... Liebeslieder, die sonst in der Popmusik die Lüge von Individualität und privatem Glück verbreiten, bilden die Ausnahme, und wenn es um Liebe geht, dann eben um die perverse Zuneigung eines Nazi-Schatzis.
Die Musik setzt diese Eliminierung aller Ausdrucksqualitäten fort: Die Gitarre klopft wie am Fließband Powerchords im Stile von Link Wray herunter, an die Stelle ausgefeilter Baßlinien tritt der stereotyp in Achteln repetierte Grundton des jeweils aktuellen Akkordes, Gitarren-, Baß- oder Schlagzeugsoli sind verpöhnt, der formale Aufbau der Stücke ist fast schmerzhaft symmetrisch. Daß diese scheinbare Primitivität überhaupt nicht einfach zu erzielen ist, einmal ganz davon abgesehen, daß sich unter der einfachen Oberfläche natürlich eine recht komplexe Struktur versteckt, bleibt dem flüchtigen Hörer verborgen, und zwar mit Absicht.
Und um zum Ende dieser Aufzählung zu kommen: Mit Fuzz ist dann die ultimative Eliminierung von Ausdruck Klang geworden. Ursprünglich stand der verzerrte Klang einer E-Gitarre noch unter dem Diktat des Ausdrucks. Die expressiven Qualitäten der E-Gitarre machten diese zum idealen Instrument, das in den fünfziger Jahren das Saxophon ablösen konnte. Und in diesem expressiven Sinn wird die verzerrte E-Gitarre auch noch bei Pink Floyd eingesetzt. Indem im Fuzz jedoch die expressive Seite des Gitarrenklangs ins Extrem gesteigert wird, schlägt die Quantität um in Qualität, von absolutem Ausdruck, in absolute Ausdruckslosigkeit. Während die Klangwolken Pink Floyds ständig zu irgendwelchen, meist bildlichen Assoziationen einladen, nimmt einem Johnny Ramones Gitarre jede Lust zum Träumen. Wenn Fuzz überhaupt noch etwas jenseits der Verweigerung von Wohlklang repräsentiert, dann am ehesten ziel- und sinnlosen Haß, ein Haß, der sich gegen das verlogene Versprechen der Popmusik wendet, Freiheit und Glück seien möglich.
Und genau das ist es, was avancierte Rockmusik ausmacht. Oder für die Eingeweihten: »Bird is the word!«
1Markus Lüpertz, zitiert nach Stefan Koldehof, »Von einem der auszuog, die Freiheit zu leben«, in: FAZ-Magazin vom 9.1.1998, S.8f.
2Vgl. hierzu Werner Bohleber und Marianne Leuzinger, »Narzißmus und Adoleszenz«, in: Psychoanalytisches Seminar Zürich, Die Neuen Narzißmustheorien, Frankfurt a. M. 1993, S.125-138.
3Greil Marcus, Lipstick Traces, Hamburg 1992.
4Bei »Drinkin' With Jesus« wird der jeweilige Hauptteil verdoppelt: Auf die Strophe folgt ein (harmonisch identischer) Refrain, aus den ursprünglichen 8 Takten werden somit 16; und zwischen die einzelnen Teile werden einige Takte als Füllsel eingefügt. Der Aufbau ist somit: Hauptteil (2 mal 8 Takte) - Zwischenspiel (3 Takte) - Wiederholung des Hauptteils (2 mal 8 Takte) - Zwischenspiel (3 Takte) - Bridge (8 Takte) - Hauptteil (2 mal 8 Takte).
5In Wirklichkeit ist dieser C-Dur-Akkord natürlich nicht unmotiviert, sondern die Motivation ist einfach bescheuert. Die zweite Hälfte der Bridge, die in der Melodie chromatisch aufwärts schreitet, benutzt die Akkordverbindung Cis-H, wobei das Cis als Dominantakkord zu fis fungiert, das dann aber durch den Parallelakkord H ersetzt wird. In diese Richtung und in diesem Zusammenhang funktioniert die Akkordverbindung. Da nun die erste Phrase chromatisch abwärts schreitet, dachten sich Pink Floyd wohl, sie könnten die Harmoniefolge des zweiten Teils einfach umkehren; genau das funktioniert aber nicht, es gibt keine rückwärtslaufende Dominantfunktion.
6»I'm a shock trooper in a stupor / Yes I am / I'm a Nazi shatze / Y'know I fight for fatherland.« - Die den Text eigentlich zerstörende ironische Distanzierung in der ersten Verszeile geht wohl auf das Konto der Plattenfirma, die sich offensichtlich absichern wollte. Live hat Joey Ramone im ersten Vers immer »I'm a Nazi, baby, I'm a Nazi, yes I am« gesungen (vgl »Let's Dance«, 1977 oder »Loco Live«, 1991).
7»Little German boy / Being pushed around / Little German boy /
In a German town«.